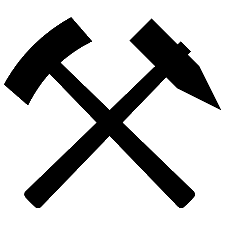Informationen rund um die Arbeit von RWE
Kohlekraftwerke verständlich gemacht
Die Kohlekraftwerke im Rheinland sind Neurath, Niederaußem und Weisweiler.
Dank dieser Kraftwerke haben wir seid Jahrzehnten sicheren und zuverlässigen Strom. Doch das soll sich nun ändern, dank der Empfehlung der Kohlekommission. Diese fordert, bis 2023 sollen 3 GW (Gigawatt) vom Netz genommen werden.
2030 soll die Erzeugungskapazität auf maximal 9 GW halbiert werden.
Und 2038 soll die Kohleverstromung gänzlich auslaufen.
Wie funktioniert ein Kohlekraftwerk überhaupt?
Wieviel leistung bringen die einzelnen Werke?
Und wie ist das Verhältnis von Windräder und Kohlekraftwerk überhaupt zueinander?
Alles fragen, die ich euch gerne in diesem Beitrag näher bringen und verständlich erklären möchte.
Beginnen wir damit, wie so ein Kohlekraftwerk überhaupt funktioniert. Ein Kraftwerk besteht meist aus mehreren Kraftwerksblöcken. Ein Kraftwerksblock besteht grob aus dem Verbrennungskessel mit Wasser-/Dampfkreislauf, auch Dampferzeuger genannt, der Dampfturbine (ähnlich eines Flugzeugtriebwerks), dem Generator, dem Kühlsystem, dem Anschluss an das Stromnetz und dem Kessel nachgelagerten Filtereinheiten für Staub, Schwefel, CO2 und Quecksilber. Dazu habe ich eine Animation eingefügt, die das ganze gut erklärt und darstellt.
Befassen wir uns nun mit den einzelnen Kraftwerken und deren Leistung. Wie oben schon geschrieben, haben wir hier im Rheinischen Revier 3 Kraftwerke.
Das Kraftwerk Neurath besteht aus 7 aktiven Blöcken:
• 2 x 300 MW (Block A + B)
• 1 x 300 MW in Sicherheitsbereitschaft Sibe** (Block C)
• 2 x 600 MW (Block D + E)
• 2 x 1000 MW (Block F und G, BOA* 2 + 3)
Die Gesamtleistung des Kraftwerks (inkl. Sibe) beträgt etwa 4400 MW.
Kurze erklärung zu BOA und Sibe:
*BOA = Braunkohlenkraftwerk mit optimierter Anlagentechnik
**Sibe = In der Sicherheitsbereitschaft bleiben die Kraftwerksblöcke noch für 4 Jahre als Backup in Notsituationen der Stromenergiewirtschaft und drohendem Blackout in Bereitschaft aber abgeschaltet. Nach 4 Jahren werden sie endgültig abgeschaltet.
Gehen wir nun weiter zum nächsten Kraftwerk im Revier.
Das Kraftwerk Niederaußem besteht aus 7 aktiven Blöcken: Die Blöcke A + B wurden bereits 2012 stillgelegt.
Der Rest ergibt sich noch aus: • 2 x 300 MW (Block C, D)
• 2 x 300 MW in Sicherheitsbereitschaft Sibe (Block E + F)
• 2 x 600 MW (Block G + H)
• 1 x 1000 MW (Block K, BOA* 1)
Die Gesamtleistung des Kraftwerks (inkl. Sibe) beträgt etwa 3400 MW.
Nun zu guter letzt, haben wir noch das Kraftwerk Weisweiler bestehend ebenfalls aus 7 aktiven Blöcken:
• 2 x 300 MW (Block E + F)
• 2 x 600 MW (Block G + H) • 2 x 270 MW (Vorschaltgasturbine VGT) • 1 x 34 MW (Müllverbrennungsanlage MVA)
Die Gesamtleistung des Kraftwerks beträgt etwa 2400 MW.
Insgesamt haben die Kraftwerke im Rheinischen Braunkohlenrevier eine Leistung von rund 10.800 MW oder 10,8 GW (inkl. Sicherheitsbereitschaft SiBe).
Ende 2019 werden nur noch folgende Braunkohlenblöcke (Ohne Sibe, Müllverbrennungsanlage, Vorschaltgasturbine, Kraftwerk Goldenberg und Kraftwerk Frimmersdorf), aktiv am Grundlaststrom beteiligt sein :
• Kraftwerk Neurath 4100 MW
• Kraftwerk Niederaußem 2800 MW
• Kraftwerk Weisweiler 1800 MW
Wie verhält sich jetzt das Kohlekraftwerk zum Windrad? Und damit meine ich jetzt die Leistung und nicht das aussehen oder sonstige Faktoren. Es geht sich nur darum wie und ob Windräder die Kohlewerke ersetzen könnten.
Der größte Braunkohlenkraftwerksblock hat eine Leistung von rund 1000 MW (1 GW).
Und ist im Kraftwerk Niederaußem. Die größten Windräder haben eine Leistung von 3 MW.
Man spricht dann von ,,installierter Leistung" (kennzeichnet die maximale Leistung, die Nennleistung)
Wie ich in meinem Beitrag über die Windräder schon beschrieben habe, liefern Windräder keinen Strom, wenn die Windstärke unter 2-3 liegt. Bei Sturm oder Orkan auch nicht, da sie aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden. Daher bringen es die Windräder auf Grund dieser Wetter-/Windbedingungen meist nur auf 20 % - 30 % der Volllaststunden.
Volllaststunden sind die Stunden pro Jahr
(365 Tage x 24 h = 8760 h).
Das bedeutet:
30 % von 8760 Stunden [h] pro Jahr = 2600 h
Installierte Leistung: 3 MW x 8760 h = 26.280 MWh
Tatsächliche Leistung: 3 MW x 2600 h = 7.800 MWh
Ein Grundlastkraftwerk in der Braunkohle bringt es auf 90 % Volllaststunden.
Rechnung:
1000 MW-Block (BOA) x 8760 h x 0,9 = 7.884.000 MWh
1000 MW : 3 MW (Leistung pro Windrad) = 333 Windräder
Man benötigt also 333 Windräder um einen 1000 MW Block in der Leistung zu ersetzen.
Aber: Das würde ja nur dann gehen, wenn die Windräder auch ihre volle Leistung erbringen würden. Durch die nur 30% Leistung die so ein Windrad im Durchschnitt bringt, benötigt man also im günstigsten Fall 3 mal mehr Windräder.
Um also einen 1000 MW-BOA-Block mit seiner Jahresstromproduktion zu ersetzen, bedarf es 1000 Windräder. Wo wir aber wieder bei den kosten sind.
1 Windrad kostet zwischen 4 und 5 Millionen €.
1000 Windräder kosten also 5 Milliarden €.
1 BOA-Block kostet 1 Milliarde €.
1000 Windräder benötigen aber auch Platz.
Pro Windrad sind dauerhaft 0,4 Hektar [ha] einzuplanen.
Da ist die Standfläche des Windrades, die Kranstellfläche und der Weg zum Windrad hin mit einzurechnen.
1000 Windräder benötigen also 400 ha Fläche.
Zur Erinnerung: Der Hambacher Restforst hat eine Fläche von 200 ha.
Und das ist nur die Fläche um 1 BOA-Block zu ersetzen.
Will man die gesamte Braunkohleverstromung im Rheinischen Revier ersetzen, werden 8700 Windräder benötigt.
Will man die gesamte Braunkohleverstromung im Rheinischen Revier ersetzen, werden 8700 Windräder benötigt. Kosten ca. 43,5 Mrd. € Flächenverbrauch 3480 ha (knapp 35 km²)
Nimmt man die ostdeutsche Braunkohle, die deutschen Steinkohlekraftwerke und die 2023 abgeschalteten Kernkraftwerke dazu, müsste man 166 TWh Stromerzeugung ersetzen.
Man müsste also gute 21.000 Windräder bauen, um das zu ersetzen.
Kosten: 104.000.000.000 € (104 Miliarden €) Flächenverbrauch: 8400 ha (84 km²)
Und das sind nur die Kosten für die Windräder, die kosten und Flächen für Stromspeicher ausgeschlossen.
Der Flächenverbrauch von 8400 ha (84 km²) ist aber nur die Fläche, die unwiederbringlich zur Bebauung und zum Anbau von Land- und Forstwirtschaft verloren geht. Wenn man jedoch 21.000 Windräder aufstellen möchte, gilt es auch einen Sicherheitsabstand von 500 m zueinander und zu Bebauungen einzuhalten. Wenn man aus den 21.000 Windrädern einen quadratischen Windpark bauen würde, macht das ein Quadrat aus 145 x 145 Windrädern. Mit außenliegendem Sicherheitsabstand ergibt das dann 147 x 500 m-Abstände in Nord-Süd-Richtung und auch in Ost-West-Richtung eine Gesamtfläche von 74 (147 : 2) km x 74 (147 : 2) km = 5476 km²
Die Bunderepublik hat eine Fläche von 357.386 km².
Bleibt also genug Fläche für Windräder übrig?
Von diesen 357.386 km² müssen wir noch die Flächen* abziehen, auf denen kein Windrad stehen kann:
• Siedlungs- und Verkehrsfläche (SuV-Fläche) 49.254 km²
-Städte und Dörfer
-Bahnlinien -Straßen und Autobahnen
-Industrieanlagen
-Flugplätze mit An-/Abflugkorridor
• Flüsse, Seen, Kanäle und Küstengewässer 8.219 km²
• Stromtrassen • Sonstige Flächen 11.300 km²
-Alpen
-Naturschutz- und Vogelschutzgebiete
-Tierparks
• Wo Bürgerinitiativen bereits Windräder verhindert haben • Windschwache Gebiete
Dazu kommen 182.637 km² landwirtschafte Flächen (Wir müssen ja auch was essen) und 106.170 km² Wälder (die am Liebsten nicht gerodet werden sollen).
Jetzt wird es aber eng mit dem Platz für Windräder!!!
Und genau da liegt das Problem, Wo sollen die Windräder gebaut werden? Wer soll das bezahlen? Und kann das überhaupt Funktionieren? Zum jetzigen Zeitpunkt ein klares NEIN. In naher Zukunft? Auch da ein klares NEIN. Irgendwann mal? Eher unwahrscheinlich, außer wir möchten eine Welt haben, in der wälder gerodet werden, um Vögel mordende, Maschienen zu bauen, die nur eine begrenzte Laufzeit haben.